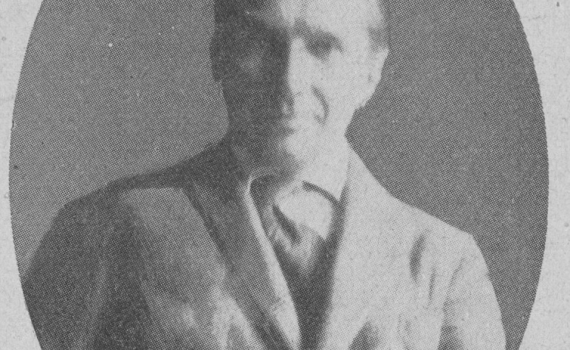
Warum immer noch keine szenische Welt-Premiere?
Category : Aufführungen | Auff de
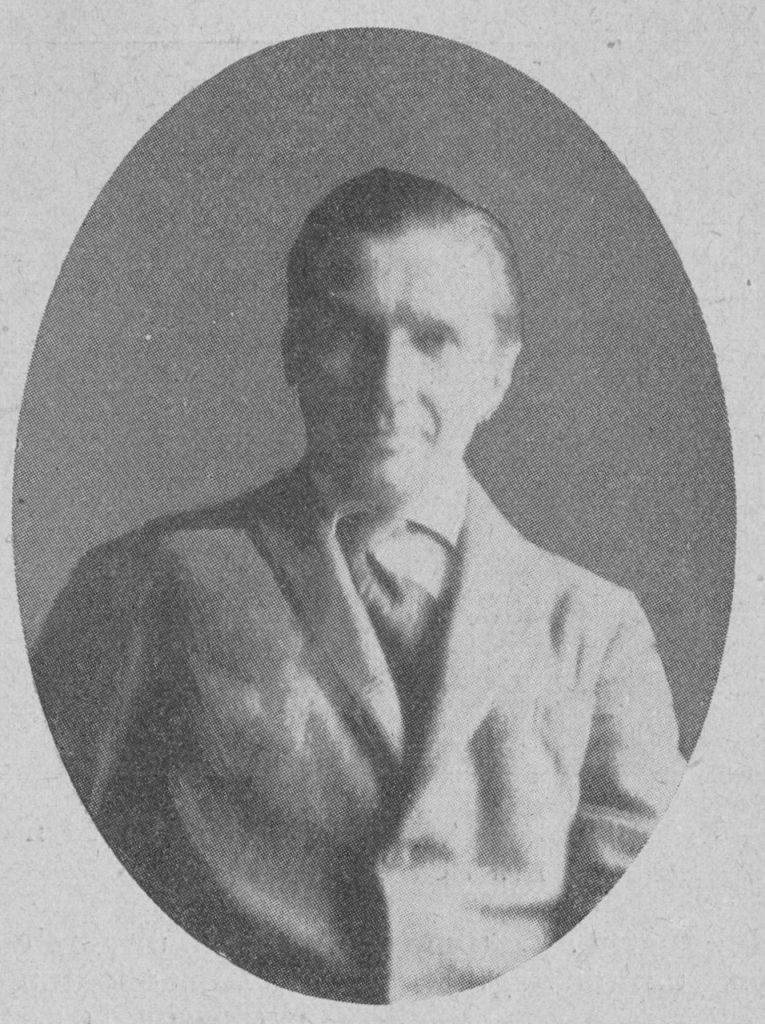
https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Dahms
Hamburg Staatsbibliothek https://resolver.sub.uni-hamburg.de/kitodo/PPN774616555_0016
[pgc_simply_gallery id=“221″]
Walter Dahms schreibt einen ausführlichen Artikel 1912 über die Oper.
Der Grund für bisher keine vollständige szenische Aufführung (immer noch 2026!) wird hier beschrieben:
Als ich zum ersten Mal den Klavierauszug von Goepfarts „Sarastro“ in die Hand nahm, erschrak ich über die Kühnheit des Schöpfers, unserer Zeit etwas so ungeheuer Einfaches, Klares und Eindeutiges zu bieten. Zwar, dieses Werk war schon zum Mozartjubiläum 1891 gedacht und geschaffen. Aber die unglücklichsten Wirrnisse (vor Allem der große Druckerstreik) hatten die in Aussicht genommene Aufführung – in Dresden und Prag- damals unterbunden. Dann im nächsten Jahr war es schon zu spät. So liegt „Sarastro“ immer noch [1912 Anm.d.Verf.] unaufgeführt da. Wenn es nach den guten Deutschen ginge, die durch ihre Lieblings-Zeitungen so schlecht über ihre schaffenden Künstler unterrichtet werden, dann könnte das Werk bis in alle Ewigkeit unaufgeführt liegen bleiben. Aber es wäre doch bedauerlich, wenn die Mauer von Trägheit und Böswilligkeit, die ein höchst einseitiger Interessen-Journalismus zwischen den Schaffenden und dem gutgläubigen Publikum aufgerichtet hat, nicht an irgend einer Stelle zu durchbrechen wäre. Der Versuch wäre lohnen, lehrreich und verheißungsvoll zugleich.
Karl Goepfarts Musikdrama „Sarastro“
Von Walter Dahms
Wer wird in unseren Tagen nicht aufhorchen, wenn er von einem Werk hört, das sich „Der Zauberflöte zweiter Teil“ nennt? Wir reden und schreiben so viel von Mozart als dem Retter aus der heutigen Musiknot, als dem Führer aus der Wüste moderner Unproduktivität. „Zurück zu Mozart!“ rief man. Weingartner meinte: „Nein, vorwärts zu Mozart!“ Mag man es auffassen, wie man will, eins ist sicher: Daß eine Weiterentwicklung der musikdramatischen Kunst niemals ein „Hinaus über Wagner“ sein kann, sondern daß der Bühnenkomponist, der etwas Seltenes, Dauerndes und auch Neues schaffen will, an einem Punkt v o r Wagner anknüpfen muß. Denn da sind noch viele unbegangene Wege, die zu dem Ziel einer großen, erhabenen Kunst führen.
Als ich zum ersten Mal den Klavierauszug von Goepfarts „Sarastro“ in die Hand nahm, erschrak ich über die Kühnheit des Schöpfers, unserer Zeit etwas so ungeheuer Einfaches, Klares und Eindeutiges zu bieten. Zwar, dieses Werk war schon zum Mozartjubiläum 1891 gedacht und geschaffen. Aber die unglücklichsten Wirrnisse (vor Allem der große Druckerstreik) hatten die in Aussicht genommene Aufführung – in Dresden und Prag- damals unterbunden. Dann im nächsten Jahr war es schon zu spät. So liegt „Sarastro“ immer noch unaufgeführt da. Wenn es nach den guten Deutschen ginge, die durch ihre Lieblings-Zeitungen so schlecht über ihre schaffenden Künstler unterrichtet werden, dann könnte das Werk bis in alle Ewigkeit unaufgeführt liegen bleiben. Aber es wäre doch bedauerlich, wenn die Mauer von Trägheit und Böswilligkeit, die ein höchst einseitiger Interessen-Journalismus zwischen den Schaffenden und dem gutgläubigen Publikum aufgerichtet hat, nicht an irgend einer Stelle zu durchbrechen wäre. Der Versuch wäre lohnen, lehrreich und verheißungsvoll zugleich.
Der „Sarastro“ machte gleich bei der ersten Bekanntschaft einen tiefen nachhaltigen Eindruck auf mich. Immer wieder habe ich das Werk vorgenommen. Mein Interesse wuchs stetig. Hier war endlich einmal ein Werk, das etwas ganz Anderes wollte, als es der Tag liebt und fördert. Hier sollen uns die menschlichen Urempfindungen nicht (wie bei den beliebten Veristen und ihren deutschen Nachtretern) verekelt – nein, hier sollen sie veredelt werden. Etwas Reines, Bodenständiges, Gesundes – kurz, etwas Deutsches spricht hier zu uns in einer kraftvollen, sentimentaler Tränenseligkeit wie krankhaften Ausbrüchen gleich abholen Wort- und Tonsprache. Deshalb nun schreibe ich hier ein mahnendes Wort für das Werk, weil ich die feste unumstößliche Überzeugung als Musiker und Kritiker gewonnen habe, daß es auch auf jeden anderen, für das Edle empfänglichen Menschen wirken muß.
Das Ganze ist eine Symbolie – der Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut uns Böse. Auch Mozarts „Zauberflöte“ hatte diese Tendenz. Sie war ein den Eingeweihten im damaligen Wien verständlicher Protest gegen das träge Beharrende, gegen die Verlotterung und Gewissensknechtung auf allen gebieten. Ohne Humanitätsdusel wollte sie das Ideal allgemeiner menschlicher Brüderlichkeit verkünden. (Allerdings, die französische Revolution, die vor der Tür stand, setzte darauf eine schrille Dissonanz – auch eine Art von Brüderlichkeit; aber eine andere!). Damals nun wollte man durch Schicksalsprüfungen geläuterte Charaktere darstellen. Feuer und Wasser waren nur Symbole. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Sarastro und der Königin der Nacht, wird jedoch in der Zauberflöte nicht ausgetragen. Das Finale weist auf die kommende Zeit hin, eine Zeit von Kampf und Streit.
Kein Geringerer als Goethe plante und entwarf einen zweiten Teil der Zauberflöte, das Drama des Sarastro, als Operntext. Auf dieser Basis nun ruht Goepfarts Werk, dessen Dichtung von Gottfried Stommel herrührt. Goethes Weiterführung der Zauberflöte war berechtigt. Der Kampf der beiden feindlichen Urgewalten, grob versinnlicht in Licht und Finsternis, mußte einmal entschieden werden. Durch den Goethe’schen Entwurf ergaben sich die dramatischen Richtlinien für Goepfart und Stommel. Mozarts Musik mußte in einigen Melodien und Motiven an bestimmten Stellen beibehalten werden. Und der Ausgang mußte ein versöhnlicher sein: Die Liebe mußte den Haß überwinden. Ebenso notwendig war die Durchführung der freimaurerischen Ideen durch den von Goethe beabsichtigten Konflikt. An der Berechtigung der Weiterführung der Zauberflöte durch Goethe wird man nicht zweifeln können; man wird sie unbedingt und freudig bejahen, wenn man die Erfüllung der gesteckten Ziele durch das Goepfart-Stommel’sche Werk in einwandfreiem Ausführen erlebt haben wird.
Die Betrachtung des „Sarastro“ zeigt, daß die Akte in ihrem Aufbau in sich ein in der Wesenheit schaft Unterscheidendes tragen. Der erste Akt bringt die Exposition. Er führt uns in die verschiedenen Welten des Dramas ein, die des Guten (Sarastro), des Bösen (Königin der Nacht) und die des Naturmenschentums (Papageno). Nach den feierlichen Einleitungsklängen der Zauberflöten-Ouverture hebt sich der Vorhang über der Versammlung der Priester. Alljährlich senden sie einen der Brüder in die Welt, um das Leid und die Freude der Menschen zu schauen. Der Erdenpilger ist wieder rein zurückgekehrt und diesmal trifft das Los Sarastro, ihren Führer, selbst. Er erkennt darin einen besonderen Wink: „Die Gottheit prüfet in Gefahr!“ Er weiß, eine ernste große Mission wartet seiner. Die alte Feindin, die Königin der Nacht, das Urböse, soll überwunden werden. Dazu ist nur er imstande; denn durch seine höhere geistige Kultur durchschaut er ihre Absichten, sie aber nicht die seinen. Ein feierlicher, ernster Ton liegt in dieser ganzen Szene. Getragene Rhythmen, klare Harmonien und tiefinnerliche Melodien breiten sich in der Musik darüber aus. Hier schon zeigt es sich deutlich: Der „Sarastro“ ist eine Gesangsoper in dem Sinne, wie Mozarts Opern es sind. Daraus ergibt sich auch die Sonderstellung des Werkes in der modernen Opernliteratur. Das Orchester hat nicht das Entscheidende zu sagen; es hat nur das Milieu zu geben, gewissermaßen den Boden, auf dem sich die Geschehnisse (musikalischer Art) abspielen.
Die erste Verwandlung führt uns in das Reich der Königin der Nacht. Ein Charakterbild entgegengesetzter Art. Hüpfende Rhythmen geben sogleich ein Bild von der kleinlichen Unruhe, die in diesem Reich herrscht. Wie Sarastro wird uns auch die Königin in der Mitte ihrer Kampfgenossen gezeigt. Monostatos, der Mohr, dem in der Zauberflöte die Tochter Pamina entgangen und der sich nun dienend und liebend zur Mutter gehalten hat, meldet der Königin, daß das Rachewerk an dem Reich des Lichts in vollem Gange sei. Tamino und Paminas Kind, der Königssohn, liege verschlossen in einem goldenen Sarg, dessen Deckel nur ihre dunkle Macht wieder öffnen könne. Symbolisch: Die neue Zeit ist in Ketten gelegt durch die lichtscheuen Geister. Das Triumphgeheul der Königin läßt ihren innerlichen Gegensatz zu dem edlen Sarastro erkennen. Wie gerecht ist sein Kampf gegen sie!
Die zweite Verwandlung zeigt uns Tamino und Pamina in elterlicher Sorge um ihren Liebling. Die sich steigernden Befürchtungen Taminos um sein Kind haben einen Rückfall in den Bannkreis seiner Mutter, der Königin der Nacht, zur Folge, die ihn zum Rachewerk an Sarastro gewinnen möchte. Aber das erweist sich als eine Versuchung Sarastros, der ihn mit Verheißungen auf die große Mission des Kindes in der Zukunft tröstet. Von der zarten Lyrik des Frauenchors, dessen Gesang das unablässige Tragen des Sarges begleitet, steigert sich die Musik in der Versuchungsszene machtvoll und leitet zu dem herrlichen urkräftigen Priesterchor „Wer will eifern wider das Licht?“
Die dritte Verwandlung führt uns das Leben und Treiben der unbefangenen Naturmenschen, verkörpert durch Papageno und Papagena, vor. Hier im lustigen Getriebe in der Kinderschar vollzieht sich unter Lust und Scherzen als Göttergeschenk die Geburt der Aurora. Sie ist das Kind des Volkes, das den Sohn des Fürstenhauses erlösen soll. Eine Musik von melodienseliger Heiterkeit begleitet diese Verwandlung. Einige Mozart’sche Melodien tauchen auf. Lebendig flutet das auf und ab, unerschöpflich und mit sicheren Strichen so einfach wie wirkungsvoll gezeichnet.
Brachte der erste Akt die Exposition des Dramas, so vollzieht sich im zweiten die Höhe der dramatischen Wirkung der Handlung in dem Auseinanderplatzen der feindlichen Gewalten. Sarastro befindet sich getreu der göttlichen Berufung auf seiner Erdenwanderung. Hierbei trifft er mit der alten Feindin zusammen. Das Schicksal der beiden Urgewalten, Licht und Finsternis, vollzieht sich. Die Königin erkennt den Wanderer nicht. Der Zauber des Unbekannten überwältigt sie und lässt sie in heftigster Liebe zu ihm entbrennen. Sie sucht ihn für ihre Zwecke, die alle als Hintergrund die Vernichtung Sarastros im Auge haben, zu gewinnen. Er willigt endlich ein, ihr bei der Beseitigung Sarastros behilflich zu sein, als sie schwört, Phöbus, den Königssohn, aus dem goldenen Sarg zu befreien und so dem Leben wiederzugeben. Sarastro erkennt, daß er sich um Opfer bringen muß, um die Königin zu überwinden und die „neue Zeit“ herbeizuführen. Die ethische Gewalt seiner Persönlichkeit und seiner Bekenntnisse ist wundervoll. Ebenso glücklich wie der Dichter diesen meisterhaften Akt aufgebaut und durchgeführt hat, ist auch Goepfart die Musik gelungen. Er schöpf hier ganz aus dem Eigenen, und der Quell der melodischen und charakteristischen Erfindung ist bei ihm unversiegbar. Mit lapidaren Strichen weiß er die Gegensätze wiederzugeben. Dramatisch wuchtig und eindringlich ist seine Tonsprache und dabei durchaus eigenartig und neu. Seine Sicherheit im Ausdruck einer Empfindung dokumentiert sich an allen Stellen. Bedeutungsvoll ist, wie die Königin der Nacht bei ihrem vermeintlichen Triumph wie mit innerster Notwendigkeit zum ersten Mal im Drama sich in Koloraturen ergeht. Hier ist die Koloratur wirklich einmal Ausdrucksmittel und zwar ein geradezu notwendiges und spannungslösendes.
Der dritte Akt ist in seiner Wirkung ungleich geartet; das ergibt sich aus der Häufung der notwendigen Lösungen. Als eine der seltenen Erscheinungen in der dramatischen Literatur finden wir hier, daß neue Personen (Aurora und Phöbus), die wesentlich an der Fortführung und Lösung der Konflikte beteiligt sind, erst im dritten Akt handelnd auftreten. Der dritte Akt muß naturgemäß in der Hauptsache Mozart’sche Motive enthalten. Das Zitieren Mozarts ist teilweise durch Goethe’sche Vermerke geboten. So tritt Aurora mit der Glockenspielmusik aus der „Zauberflöte“ auf. Einer Rechtfertigung bedarf es da nicht; denn hier konnten eben keine anderen Töne erklingen, als die Mozarts. Goepfart benutzt in den einzelnen Nummern die musikalische Rondoform, wie sie Mozart vielfach anwandte. Denn er mußte im Stil bleiben. Man sage nicht, er habe sich die Sache einfach und leicht gemacht durch das Zitieren Mozart’scher Musik. Im Gegenteil, es war eine ungeheure Schwierigkeit, die eigene Empfindung dem Stil und dem Geist Mozarts anzupassen, um das Ganze nicht zerfallen zu lassen. Er hätte ja auch für die Zitate eigene Erfindung setzen können. Aber mit Recht erschien ihm Mozarts Ausdruck an den bestimmten Stellen als der einzig mögliche.
Die erste Szene führt uns wieder zu den Naturmenschen in den Wald. Hier vollzieht Aurora die Befreiung des Phöbus und damit die Wiedergabe des prometheischen Göttergeschenkes an die Menschen. Die Handlung steigert sich zur innigsten Liebesszene der beiden symbolischen Gestalten. Eine burleske Szene, ein Panfest, wenn man so sagen will, folgt, mit einer reizvollen aparten Ballettmusik geschmückt.
Die erste Verwandlung zeigt uns ein Stück aus dem Hofleben in Taminos Königspalast. Damen und Herren streiten sich um das Neueste. Dem unfruchtbaren Streite wird ein Ende gemacht durch die Ankündigung des Allerneuesten: Des Einzugs des erlösten Prinzen Phöbus mit Aurora. Damit beginnt der Anfang vom Ende. Die neue Zeit erscheint. Ergötzliche Töne hat Goepfart für die Konversation der Hofleute gefunden, Töne, die ihn als einen Meister des musikalischen Humors zeigen.
Eine offene Verwandlung führt zum Finale. Hier treten die schneidendsten Kontraste zwischen dem freudigen Jubel über den Einzug des jungen Fürstenpaares und der Trauer der Priester um den Tod Sarastros auf. Diese beiden Szenen konnten nur mit Motiven Mozart’scher Prägung dargestellt werden, mit dem Jubelchor aus dem Zauberflöten-Finale und mit der Feuer- und Wassermusik in c-moll. Im weiteren Verlauf der Handlung, so zum Eindringen der Königin der Nacht, die auch zu einem Sieges- und Jubelfest erscheint, hat Goepfart eigene, sehr charakteristische Akzente gefunden. Die Handlung entwickelt sich zur Katastrophe. Die Königin verlangt ihren toten Feind zu sehen: „und sollt‘ mein reich in Trümmer gehen“! Tamino führt sie zu Sarastro Sarkophag. Als sie da in dem Toten den Wanderer wiedererkennt, sinkt sie ohnmächtig nieder. Währenddessen ertönt das „O Isis und Osiris“ in Mozarts unsterblicher Melodie von sämtlichen Priestern im Einklang gesunden als Gelübde, auch nach Sarastros Tode in seinem Sinne tätig zu sein. Überwältigt von der furchtbaren Erkenntnis (der eigenen Niederlage), die ihr geworden, äußert die Königin lebhaftes Verlangen zum Eintritt in den hohen Bund der Liebe, wird aber von den Priestern entrüstet zurückgewiesen. In ihrer Seelenangst ruft die Königin der verklärten Sarastro (ihren Feind und Freund) an, ihr ein Zeichen seiner Versöhnung und Erfüllung ihres Wunsches zu geben. Es geschieht. Ein Genius erscheint, berührt die Königin mit der Friedenspalme und führt sie in das Reich des ewigen Friedens ein. Sarastro und die Königin erscheinen vereint in der Kuppel – die Liebe hat den Haß überwunden. Damit sind alle Übel getilgt. Herrschergeschlecht und Volk stimmen nun in noch ganz anderem Hochgefühl den Jubelchor der Befreiung durch die Liebe an.
Goepfart-Stommels „Sarastro“ zeigt sich als ein Werk von ethischer Tendenz und reinem, großen Wollen. Daß das Können mit dem Wollen Schritt hält, vermag man unzweifelhaft aus der Dichtung und Musik zu erkennen. Daß auch der Erfolg einem so ernsten und schöngelungenen Werk nicht versagt bleibe, dafür haben die deutschen Operntheater zu sorgen. Ihnen liegt es ob, einem Werk zur Geltung zu verhelfen, das in seiner hohen Idee, in der Einfachheit und Gewalt seiner Konzeption und Ausführung aus dem Durchschnitt herausragt, das durch seine innerliche Schlichtheit und Wahrheit eine Ausnahmestellung in dem zeitgenössischen Schaffen einnimmt, und das – davon bin ich fest überzeugt- stets einen tiefen, nachhaltigen Eindruck machen wird. Die deutsche Bühne, die mit Goepfarts „Sarastro“ den Anfang macht, wird den Rum einer wirklichen künstlerischen Tat für sich haben.